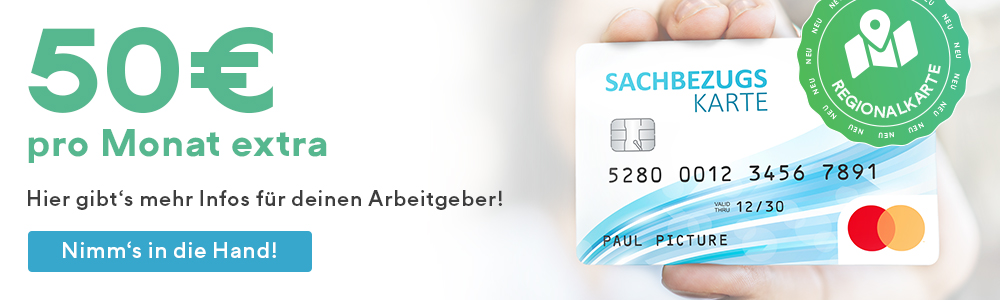Die Europäische Währungsunion (EWWU) hat sich mit elf Mitgliedsstaaten zusammengeschlossen, um allgemein gültige Verhältnisse für Stabilität und Wachstum in geldpolitischen Angelegenheiten zu schaffen. Dabei verlangt der Stabilitäts- und Wachstumspakt die Mitglieder der EWWU verpflichtend, den jeweiligen Staatshaushalt ausgeglichen zu halten, um zur Stabilität der Währungen beizutragen. Diese Ausgeglichenheit des Staatshaushaltes jedes einzelnen Mitgliedes ist unabdingbar, wenn es um eine Währungsgemeinschaft geht, die die EWWU darstellt.
Dieser Stabilitäts- und Währungspakt der EWWU war dafür ausschlaggebend, dass sich Deutschland im Jahre 1999 für den Euro entschieden hat. Als enormes Defizit im Stabilitäts- und Wachstumspakt sieht man es an, dass die Mitglieder der EWWU zur Überwachung der Regelungen und zur Bewertung der Maßnahmen eingesetzt werden. Es hat den Anschein, als wäre ein unabhängiger Rating-Zusammenschluss objektiv die besseren Methoden, über die Defizitstände der Mitgliederstaaten der EWWU zu wachen.
Nichtsdestotrotz hält der Stabilitäts- und Währungspakt die grundlegenden Regelungen für die gemeinsame Währung bereit, sodass eine Art Regelwerk entstanden ist, welches den Mitgliederstaaten aufzeigt, mit welchen Rechten und Pflichten der Stabilitäts- und Wachstumspakt einhergeht. Um die Stabilität der gemeinsamen Währung beibehalten zu können, gibt es unter anderem die Demografieverfestigung. Diese besagt, dass die Sozialversicherungen der Altersstruktur eines Landes angepasst sein müssen, um Land und Währung stabil zu halten.
Stabilitäts- und Wachstumspakt
Der Stabilitäts- und Wachstumspakt ist eine Vereinbarung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion zur Stabilisierung des Euro.